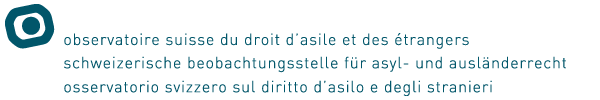Rund 80 Personen nahmen am 30. Oktober im Kongresszentrum Kreuz in Bern an einem von der SBAA organisierten Podium teil. Carola Smolenski (Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer SRK Bern), Laura Rossi (Anwältin) und Thomas Segessenmann (Staatssekretariat für Migration, SEM) diskutierten über die Bedeutung und Auswirkungen von Traumata, die Bedürfnisse von geflüchteten, traumatisierten Menschen und die dringenden Veränderungen. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Journalistin Rita Jost.
Im Rahmen eines Inputreferats erläuterte Franziska Müller von Interface Politikstudien die Herausforderungen bei der Früherkennung und Behandlung von traumatisierten Asylsuchenden. Als Grundlage dafür diente die Interface-Studie «Psychische Gesundheit von traumatisierten Asylsuchenden: Situationsanalyse und Empfehlungen – Bericht zuhanden des BAG, Sektion Gesundheitliche Chancengleichheit» (2018). Franziska Müller hielt fest, dass nationale Zahlen zu traumatisierten Asylsuchenden fehlen. Gemäss internationalen wissenschaftlichen Studien leiden 30 bis 60 Prozent an einer Traumafolgeerkrankung. Sie kritisierte, dass es in den Bundesasylzentren zwar eine Information, aber keine obligatorische medizinische Konsultation gibt und diese vor allem auf die physische – und nicht auf die psychische – Gesundheit ausgerichtet ist.
Die Forderung zur Einführung einer obligatorischen medizinischen Konsultation wurde auch vom Publikum aufgegriffen. Thomas Segessenmann entgegnete jedoch, dass das SEM ein Screening aus Geldmangel nicht umsetzen kann und weil es an genügend ausgebildeten Psychiater*innen fehle. Carola Smolenski forderte als Zwischenschritt, dass zumindest besonders verletzliche Personen früher identifiziert werden, denn auch Psychotherapeut*innen und spezifisch geschultes Pflegefachpersonal könnten Abklärungen vornehmen. Bei den Behörden sei zudem eine verstärkte Sensibilisierung und Schulung notwendig, da Traumata bei asylsuchenden Personen keine Ausnahme seien. Smolenski forderte zudem besonderen Schutz für Kinder und Jugendliche.
Die Anwältin Laura Rossi wies darauf hin, dass die Schweizer Behörden dazu verpflichtet sind, Opfer von Folter und Menschenhandel zu identifizieren und bei Hinweisen Abklärungen vorzunehmen. Tun sie das nicht, verletze die Schweiz ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen. Für die Untersuchung von Folter ist das «Istanbul-Protokoll» die wichtigste rechtliche und internationale Grundlage. Carola Smolenski forderte das SEM dazu auf, medizinische Berichte beim Ambulatorium anzufordern und sprach sich unter anderem bzgl. Istanbul-Protokoll für eine gezielte Zusammenarbeit aus.
Bei Asylverfahren gilt der Grundsatz «ohne Glaubhaftigkeit kein Asyl». Asylsuchende müssen ihre Fluchtgründe detailliert, glaubhaft und möglichst widerspruchsfrei erzählen. Anwältin Laura Rossi wies darauf hin, dass die gesuchstellenden Personen ihre Schilderungen nicht beweisen, sondern glaubhaftmachen müssen. Sie forderte, dass im Asylverfahren der Grundsatz «in dubio pro refugio» (im Zweifel für die Gesuchsteller*in) umgesetzt wird: Wenn die Schilderungen der gesuchstellenden Personen überwiegend wahrscheinlich seien, dann seien sie als glaubhaft zu betrachten.
Radio RaBe, RaBe-Info vom 30. Oktober: «Traumatisierte Geflüchtete benachteiligt»
Fachbericht der SBAA «Glaubhaftigkeit im Asylverfahren» (2019)